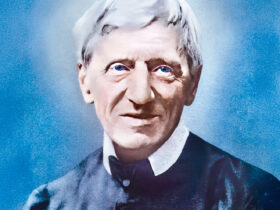Die Aufständischen in der Vendée schmückten ihre Banner mit Darstellungen des Heiligsten Herzens Jesu (Sacré Coeur). Während der Märsche beteten sie den Rosenkranz. Sie nahmen regelmäßig an den vom revolutionären Regime verbotenen Heiligen Messen teil, die von „illegalen“ („nicht vereidigten“) Priestern gehalten wurden.
Das Volk will keine antichristliche Revolution
Die verfügbaren historischen Quellen aus der Zeit der Französischen Revolution (z.B. die Akten der Revolutionstribunale) belegen eindeutig, dass auf dem Höhepunkt des revolutionären und antichristlichen Terrors zwischen 1792 und 1794 fast 80 % der Menschen, die auf der Guillotine hingerichteten wurden, Vertreter des „dritten Standes“ waren. Bei den Getöteten handelte es sich also hauptsächlich um Bauern und Bürger, also um jene Gesellschaftsschichten, in deren Namen und zu deren „Wohl“ die Revolution in Frankreich seit 1789 stattfand. Dieses volksfeindliche Gesicht der totalitären Demokratie, die durch die Französische Revolution eingeleitet wurde, zeigte sich am dramatischsten in der Vendée. Die Bauern dieser, im Westen Frankreichs gelegenen, Region bewaffneten sich im Frühjahr 1793 gegen die Republik und kämpften in den Reihen der von ihnen geschaffenen Katholischen und Königlichen Armee gegen diejenigen, die versprachen, «die Welt neu zu beginnen».
Der Name dieser aufständischen Armee spiegelte die tiefste Motivation der Teilnehmer an diesem Volksaufstand wider. Sie griffen zu einer Zeit zu den Waffen, als die Revolutionäre die brutalste Phase ihrer Entchristianisierungspolitik einleiteten (Verbot des christlichen Gottesdienstes in ganz Frankreich, blutige Verfolgung des katholischen Klerus). Die Verschärfung der antikatholischen Politik des Revolutionsstaates fällt mit der Hinrichtung von König Ludwig XVI. (21. Januar 1793) und der Anordnung der allgemeinen Wehrpflicht (levée en masse) durch die Revolutionsbehörden im März 1793 zusammen.
Das erste Ereignis war eine Bestätigung für die Vendéer, dass in Paris ein Regime etabliert worden war, das alle altehrwürdigen religiösen und politischen Traditionen Frankreichs mit Füßen trat (der König war schließlich „der Gesalbte Gottes“). Das zweite wurde als unannehmbare Usurpation (widerrechtlich die Macht an sich reißen, Anm. d. Übers.) der republikanischen Regierung wahrgenomen. Unter der Monarchie, die ihre militärischen Unternehmungen auf eine Berufsarmee stützte, war dies undenkbar. Die Bauern der Vendée waren nicht bereit, einen Blutzoll für ein Regime zu zahlen, das sie als gottlos und antifranzösisch ansahen.
Unter den Bannern des Sacré Coeur
Im Frühjahr 1793 brach in der Vendée ein spontaner Aufstand aus. Es war von Anfang an ein Volksaufstand. Wenn es im Frankreich der Revolutionszeit irgendwo einen Ort gab, an dem die Maxime „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ (das Leitmotiv der Revolution) galt, so war es paradoxerweise dort. Die Anführer der aufständischen Truppen wurden durch offene und allgemeine Wahlen bestimmt. Dies wurde später sogar von Napoleon selbst anerkannt: „In der Armee der Vendée herrschte dieses große Prinzip [der Gleichheit]“.
Einige Vertreter des vendéischen Adels mussten von den Bauern buchstäblich gezwungen werden, das Kommando über einzelne Einheiten der Katholischen und Königlichen Armee zu übernehmen. Den legendären Kommandeur der aufständischen Truppen, François de Charette, musste man buchstäblich unter dem Bett hervorziehen. Weniger drastisch, aber dennoch nicht ohne Zwang, wurden andere prominente Kommandeure des Aufstands in der Vendée – Marquis Charles de Bonchamps und Graf Henri de la Rochejaquelein – zur Teilnahme „überredet“.
Die Bewaffnung und die Kampfweise der Vendéer beschreibt der Bericht eines ihrer Mitstreiter aus Louroux-Bottereau: „Unsere Armee bestand aus Bauern wie mir, gekleidet in Kittel oder grobe Mäntel, bewaffnet mit Flinten, Pistolen, Musketen, oft mit einfachen Werkzeugen – Sensen, Stöcken, Äxten, Messern, die zum Stoßen oder als Spieße verwendet wurden. Wir organisierten uns in Pfarreien und Bezirken, unter dem Kommando eines bestimmten Anführers. Wir marschierten direkt auf den Feind zu, knieten zuerst nieder und erhielten den Segen unserer Priester, dann begannen wir mit einem unerbitttlichen Schusswechsel, wahrscheinlich ungeordnet, aber dicht und gut gezielt. […] Unsere Kommandeure kannten nur den Befehl : ‚Zielt, Jungs, da sind die Blauen [d. h. die republikanischen Truppen – Anm. G. K.]“. Auf dieses Signal hin breiten wir uns fächerförmig aus, um den Feind zu umzingeln’.
Die Vendéer kämpften in ihrer Heimat. Dies war ihr Vorteil, vor allem in der ersten Phase des Krieges, als der Überraschungsfaktor noch wirksam war. Die spezifische Beschaffenheit des Terrains dieser französischen Provinz war von großer Bedeutung. Bei Ausbruch des Aufstands war die Vendée eine bewaldete Provinz, in der man sich leicht verirren, aber auch leicht eine Falle stellen konnte. Wie sich General Jean-Baptiste Kléber, Kommandeur der republikanischen Truppen in der Vendée, erinnerte, glich das Gelände, in dem er operieren musste, „einem dunklen, tiefen Labyrinth, in dem man sich nur tastend fortbewegen konnte; in diesem wahrhaftigen System natürlicher Hindernisse und Barriren musste man nach verschlungenen Wegen suchen“.
Wie der zeitgenössische Forscher der Geschichte des Vendée-Aufstands R. Secher betont, war jedoch weder die Beschaffenheit des Terrains noch die Art und Weise der Organisation der Aufständischen-Armee der wichtigste Faktor. Der wichtigste Faktor war die Moral. Diese wiederum beruhte auf einem lebendigen Glauben. Die Aufständischen in der Vendée schmückten ihre Fahnen mit Bildern des Heiligsten Herzens Jesu (Sacré Coeur). Auf ihren Märschen beteten sie den Rosenkranz. Sie nahmen regelmäßig an den vom Revolutionsregime verbotenen Messen teil, die von „illegalen“ („nicht vereidigten“) Priestern zelebriert wurden.
Sogar die Todfeinde der Aufständischen in der Vendée schätzten deren Tapferkeit und Widerstandskraft. General Louis-Marie Tourreau, der die „Höllenkolonnen“ befehligte, die alles Leben in der Vendée zerstörten, nannte die Vendéer „ein wirklich außergewöhnliches Volk“. Für ihn waren sie „ein furchtbarer Gegner, der in der Geschichte in die erste Reihe der tapferen Völker gestellt werden muss“. Napoleon hingegen nannte die Vendéer „ein Volk von Riesen“.
Siege und Niederlagen
Bis Mitte Juni 1793 hatten die Katholische und die Königliche Armee fast die gesamte Vendée erobert. Der Höhepunkt der Erfolge der aufständischen Truppen war die Einnahme von Angers am 18. Juni 1793. Der Wendepunkt des gesamten Krieges war jedoch der gescheiterte Sturm der Vendéer auf Nantes. Die Eroberung hätte es ermöglicht, sich mit der Bretagne zu verbinden, die ebenfalls den neuen revolutionären Ordnungen feindlich gegenüberstand. Am 29. Juni 1793 wurde J. Cathelineau, der Oberbefehlshaber der aufständischen Truppen, während des Angriffs auf Nantes tödlich verwundet. Der Tod anderer charismatischer Befehlshaber der Vendéer auf den Schlachtfeldern (Bonchamps und d’Elbé) in den folgenden Monaten trug sicherlich zur Schwächung der gesamten aufständischen Armee bei. Das Fehlen unangefochtener Autoritäten führte zu einem Mangel an Einheitlichkeit in der Führung der aufständischen Einheiten. Ein ernstes Problem war die mangelnde Koordination zwischen den verschiedenen Einheiten der Aufständischen.
Die Republik, die sich im Frühjahr und Sommer 1793 mit den Kräften der antifranzösischen Koalition am Rhein auseinandersetzen musste, begann, immer mehr Kräfte an die Vendée-Front zu verlegen. Im September 1793 ermöglichte eine Verbesserung der militärischen Lage an den östlichen Grenzen der Republik die Verlegung der 20.000 Mann starken, erfahrenen Armée de Mayence (Mainzer Armee) von General Kléber in die Vendée. Die zahlenmäßige Überlegenheit der Republik und die unbegrenzten strategischen Reserven (an Bevölkerung und Material) gegenüber der Vendée führten dazu, dass sich die Kriegswaage ab Herbst 1793 entscheidend zugunsten der „Blauen“ zu neigen begann. Dieses Ungleichgewicht konnte auch durch die sporadische und unregelmäßige britische Unterstützung der aufständischen Kräfte nicht ausgeglichen werden.
Erst am 19. September 1793 errangen die Vandéer bei Torfou einen Sieg über die Armee der Republik. Dies war jedoch ihr letzter bedeutender militärischer Erfolg. Einen Monat später folgte die Niederlage bei Cholet. Am 14. November 1793 endete ein Versuch, Granville zu erobern, mit einer weiteren Niederlage. Die letzte Katastrophe ereignete sich am 21. Dezember 1793 bei Savenay. Nach der Schlacht berichtet General François Joseph Westermann, der Befehlshaber der Blauen, stolz vor dem Nationalkonvent (dem revolutionären Parlament): „Republikanische Bürger, die Vendée gibt es nicht mehr, sie fiel unter den Schlägen unseres freien Säbels, zusammen mit ihren Frauen und Kindern. Ich habe sie soeben in den Sümpfen und Wäldern bei Savenay begraben. Auf Euren Befehl hin habe ich die Kinder mit den Hufen unserer Pferde zertreten und die Frauen getötet, damit sie nicht noch mehr Banditen gebären. […] Überall liegen Leichen auf den Straßen. Es sind so viele, dass sie man an vielen Stellen zu Pyramiden stapeln könnte. […] Wir nehmen keine Gefangenen, weil sie gefüttert werden müssten, und Barmherzigkeit ist keine revolutionäre Tugend.“
Französischer Bürgerkrieg und Völkermord
So beschrieb der republikanische General die letzte und grausamste Phase des Krieges in der Vendée. Die von den Behörden der revolutionären „totalitären Demokratie“ angeordnete und von den „blauen“ Truppen akribisch durchgeführte Auslöschung der Bevölkerung der Vendée hatte ein solches Ausmaß, dass sie zu Recht als erster Völkermord in der Geschichte des modernen Europas bezeichnet werden kann. Im Juli 1793 wurde, während einer Debatte im Konvent, offen von einem „Plan zur totalen Vernichtung“ der Vendée gesprochen. Am 1. August 1793 beschloss das Revolutionsparlament die Zerstörung der Vendée, beginnend mit den Wäldern und dem Viehbestand. Am 1. Oktober 1793 erließen die Abgeordneten des Konvents einen Befehl an die Soldaten der Republik: „Soldaten der Freiheit, bis Ende Oktober muss die Ausrottung der Banditen aus der Vendée durchgeführt werden!“.
Der letztgenannte Begriff wurde sehr weit gefasst. In den Berichten der revolutionären Behörden ist es charakteristisch (und typisch für alle Totalitären), den Gegner zu entmenschlichen, der ausgelöscht werden sollte. Zuerst sollten die Frauen, die als „Fortpflanzungsboden“ bezeichnet wurden, umgebracht werden. Dann die Kinder, „weil sie zukünftige Rebellen werden“. Der Oberbefehlshaber der Armee des Westens, General Tourreau, brachte es auf den Punkt: „Die Vendée muss zu einem nationalen Friedhof werden“.
Die Begründer der französischen „totalitären Demokratie“ beschäftigte nur eine Frage: Wie konnte man in kürzester Zeit die größtmögliche Anzahl von Menschen auslöschen? Während der Debatten im Nationalkonvent und im Komitee für öffentliche Sicherheit wurden verschiedene Vorschläge gemacht. Es gab Pläne für den Einsatz chemischer Waffen in Form einer „Lösung, die die Luft im gesamten Gebiet tödlich vergiften kann“ oder für die Vergiftung von Brunnen mit Arsen. Es wurde auch an „Giftminen“ gedacht.
Jean-Baptiste Carrier, der mit der Überwachung der Ausrottung der Vendée beauftragte Kommissar des Konvents, forderte: „Lasst uns nicht auf den Gedanken kommen, von Menschlichkeit gegenüber den wilden Vendéern zu sprechen; wir werden sie alle ausrotten“. Er blieb seinen Erklärungen treu. Er plante und überwachte persönlich das massenhafte Ertränken seiner Landsleute in Kähnen in der Mitte der Loire (noyades). Zu Beginn des Jahres 1794 drangen die „Höllenkolonnen“ der „Blauen“ tief in die Vendée ein. Ihr Befehlshaber – der bereits erwähnte General Tourreau – erklärte in einem Befehl vom 17. Januar 1794: „Soldaten, wir brechen in ein rebellisches Land auf. Ich befehle euch, alles zu verbrennen, was ihr finden könnt, und jeden, den ihr trefft, mit einem Bajonett zu erstechen. Ich weiß, dass es dort einige Patrioten [Sympathisanten der Revolution – Anm. G. K.] geben kann; es ist schwer, wir müssen alles opfern“.
Was lehrt die Geschichte des Aufstandes in der Vendée?
Die Bilanz dieser Vernichtung, die sowohl Menschen als auch die Natur betraf, war schrecklich. Wie R. Secher berechnete, starben von den 815.000 Vendéern, die im Januar 1793 in der Provinz lebten, 117.000 an den Folgen der systematischen Ausrottung. Von den 53.000 Häusern wurden mehr als 10.000 zerstört. Die Vendée sollte von der französischen Landkarte verschwinden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Am 7. November 1793 beschloss der Konvent, den Namen des Departements „Vendée“ in „Vengé“ [gerächt] zu ändern.
Das Schicksal der Bauern in der Vendée ist eine Vorahnung auf das Schicksal der Bauern aus dem Wolgagebiet und der Ukraine, aus China und Kambodscha, die von der totalitären „Volksmacht“ grausam ausgelöscht wurden. Die Beschreibungen des Krieges in der Vendée wurden Ende des 19. Jahrhunderts von den jungen türkischen Offizieren gelesen, die im Ersten Weltkrieg den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts (die Vernichtung der Armenier) organisierten.
Der heilige Johannes Paul II., der während seines Pontifikats unermüdlich das große Martyrium der Weltkirche aufzeichnete, erhob viele der Opfer des Völkermords in der Vendée auf die Altäre. Damit erkannte er sie offiziell als Märtyrer für den Glauben an.